In diesem Blogartikel wollen wir über ein Thema sprechen, das viele unterschätzen: das Thema "Diagnosen von Krankheiten" und die Gefahren, die von ihnen ausgehen. Leider ist dieses Wissen viel zu wenigen Ärzten bekannt und sind Fehldiagnosen häufiger als die meisten sich vorstellen wollen.
Was ist eine Diagnose genau?
Anfangs solltest Du Dir die Frage stellen, was eine Diagnose überhaupt ist? Das Wort Diagnose stammt ursprünglich aus dem Griechischen von "Diagnosis" und bedeutet wörtlich übersetzt, “dia” auf Deutsch hindurch und "Gnosis" übersetzt Wissen oder Erkenntnis.
Bezogen auf die moderne Heilkunde und Medizin bedeutet es, dass man Symptome, die bei einem Menschen festgestellt werden, versucht, durch sein Wissen und Weltbild zu bewerten, zu beurteilen und einzuordnen.
Man erschafft mit der Diagnosestellung ein Abstraktum, das vorher überhaupt nicht existierte. Vor der Diagnose gab es nur subjektive und objektive Symptome. Symptome sind wertfrei zu betrachten.
Den Blogartikel als Video
Die Entstehung von Diagnosen bzw. Fehldiagnosen
Es wird nun ein Krankheitsbild erschaffen, indem man bestimmten Symptomen einen Namen gibt. Zum Beispiel fasst man Symptome A, B und C zusammen und es entsteht dadurch Krankheitsbild XY. Oder es werden Symptome drei, fünf und sieben zusammengefasst und es entsteht dadurch ein völlig anderes Krankheitsbild, Krankheitsbild Z beispielsweise.
Ein aktuelles Beispiel ist Covid-19. Bekannte Symptome werden zusammengefasst und mit einem Krankheitsnamen “etikettiert”. Die Symptome bei Covid-19 sind gemäß infektionsschutz.de:
Halsschmerzen, Heiserkeit, Husten, Fieber, Schnupfen sowie Störungen des Geruchs- und/oder Geschmackssinns. Weitere Symptome sind beispielsweise Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, allgemeine Schwäche, Lymphknotenschwellung, Hautausschlag, Bindehautentzündung oder auch Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall.
Wenn diese genannten Symptome einzeln betrachtet werden, können auch ganz andere Krankheiten als SARS-CoV-2-Infektion diagnostiziert werden. Symptome geben eine neutrale Sicht, während Diagnosen immer Interpretation sind. Und über die bestimmt wer?
Das bedeutet, je nach den erhobenen Befunden kann man unterschiedliche Diagnosen stellen. Bei falscher Interpretation entstehen Fehldiagnosen.
Die Krankheit kommt mit der Diagnose, vorher waren es nur Beschwerden.
Helga Schäferling (*1957), deutsche Sozialpädagogin
Diagnosen unterliegen dem Zeitgeist
Es ist wichtig zu verstehen, dass Diagnosen von Zeitgeist und Modetrends beeinflusst sind. Früher glaubte man, dass Krankheitsbilder oder Symptomatiken durch böse Geister entstehen. Dann dachte man, es sind Bakterien oder Viren.
Jetzt glaubt man, dass auch die Gene einen bedeutenden Einfluss haben. Mittlerweile geht man aber schon einen Schritt weiter und sagt, dass es auch Faktoren außerhalb der Gene gibt, die durch unsere tägliche Lebensweise repräsentiert werden.
Das heißt also, Du solltest Dich nicht nur auf ein Weltbild festlegen. Viele Menschen wollen einem Modell glauben, aber letztendlich sind das alles Erklärungen, die dem Zeitgeist unterliegen.
Symptome unterliegen demnach nicht dem Zeitgeist, Diagnosen und die Entstehung von Krankheitsbildern unterliegen ihm aber sehr wohl.
Die drei Arten von Diagnosen
Es gibt drei Arten von Diagnosen, die von Ärzten und Therapeuten gestellt werden.

Die Ausschlussdiagnose
Es gibt sogenannte Ausschlussdiagnosen. Wenn zum Beispiel bei einem Patienten der Verdacht auf einen Herzinfarkt besteht, dann soll erst einmal dieser Notfall ausgeschlossen werden oder auch andere akute Gefahren, bevor nach anderen Krankheitsbildern gesucht wird.
Bei Verdacht auf aufgerissene Blutgefäße im Körper muss diese Vermutung zuallererst ausgeschlossen werden, da eine innere Blutung schnell zum Tod führen kann. Falls der Verdacht zutrifft, sofort nach Notfallkriterien behandelt werden. Mit einer Ausschlussdiagnose soll immer ein Notfall ausgeschlossen werden.
Die Arbeits- und Verdachtsdiagnosen
Die zweite Art von Diagnosen sind klassische Arbeits- und Verdachtsdiagnosen, also das, was ein Therapeut tagtäglich anwendet. Hierbei untersucht der Arzt den Patienten, erhebt die Befunde, zieht Laboruntersuchungen zurate, usw.
Anschließend erstellt er aufgrund all dieser Informationen eine Verdachtsdiagnose. Wie der Name schon sagt, ist diese Diagnose nicht zu 100 Prozent sicher. Der Therapeut notiert in seinem Befund V.a, d.h. Verdacht auf, und dahinter steht die Krankheitsbezeichnung.
Die Differenzialdiagnose
Die sogenannte Differenzialdiagnose wird angewandt, wenn jemand beispielsweise Schmerzen im Bauch hat, aber die Ursache unbekannt ist.
Hier muss der Arzt erst einmal lernen, zu differenzieren. Beispielsweise kann es vom Magen kommen, von der Leber, vom Darm, von der Niere oder vom Unterleib.
Der Arzt musst also differenzieren, von welchem Krankheitsprozess diese Symptomatik stammen könnte.
Das sind die kurzen Erklärungen für die drei Diagnosearten. In diesem Bereich sind Diagnosen sinnvoll.
Die moderne Diagnose deckt mehr auf als dem Patienten gut tut.
Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger (*1939), Prof. Dr., deutscher Chemiker
Wieso Diagnosen gefährlich sein können
Kommen wir jetzt zu dem Bereich, wo Diagnosen gefährlich oder zumindest sehr problematisch sein können. Was viele nicht verstehen, ist, dass mit der Diagnosestellung auch immer eine Prognose verbunden ist.
Es ist wie bei einer Ehe: Der Partner der Diagnose ist immer die Prognose, und zwar die Prognose der Diagnose. Das Krankheitsbild, das mit der Diagnose erschaffen wird, hat auch immer eine entsprechende Prognose bezogen auf ihren Verlauf.
Das Wort Prognose stammt ebenfalls aus dem Griechischen und bedeutet Vorwissen. Und dieses Vorwissen basiert auf selbst gemachten Erfahrungen, aber auch auf den Darstellungen in den Medizinbüchern.
Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Diagnosen vom derzeit vorherrschenden Menschen- und Weltbild abhängen. So bekommt zum Beispiel jemand die Diagnose einer bösartigen Erkrankung.
Und mit dieser Diagnose ist die Prognose verbunden, dass er noch eine Überlebenswahrscheinlichkeit von vielleicht 10 Prozent hat. Was macht das mit dem Menschen? Es nimmt ihm wahrscheinlich jegliche Art von Hoffnung.
Wenn nun das Leben mit der Diagnose stark von Angst und Hoffnungslosigkeit geprägt ist, wird es zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung.
Das ist das Gefährliche an Diagnosen. Denn Diagnosen können auch falsch sein, sogenannte Fehldiagnosen.
Es gibt einen Witz unter Therapeuten, der heisst: "Drei Ärzte und vier Diagnosen", was nichts anderes bedeutet, als dass Therapeuten Fehldiagnosen stellen können.
Viele Ärzte überschätzen ihre Fähigkeiten, kritisieren Forscher, und fordern gezielte Maßnahmen, um im schlimmsten Fall tödliche Fehldiagnosen zu vermeiden.
Arthur Elstein, emeritierter Professor von der University of Illinois in Chicago, hat sich fast sein gesamtes Berufsleben lang mit Irrtümern der Götter in Weiß beschäftigt. Nach seiner Schätzung liegen Mediziner in etwa 15 Prozent aller Fälle falsch.
Der Trugschluss der Technik in der Medizin
Um Fehldiagnosen durch Menschen zu vermeiden, sollen nun vermehrt Programme entwickelt werden, die künstliche Intelligenz nutzen.
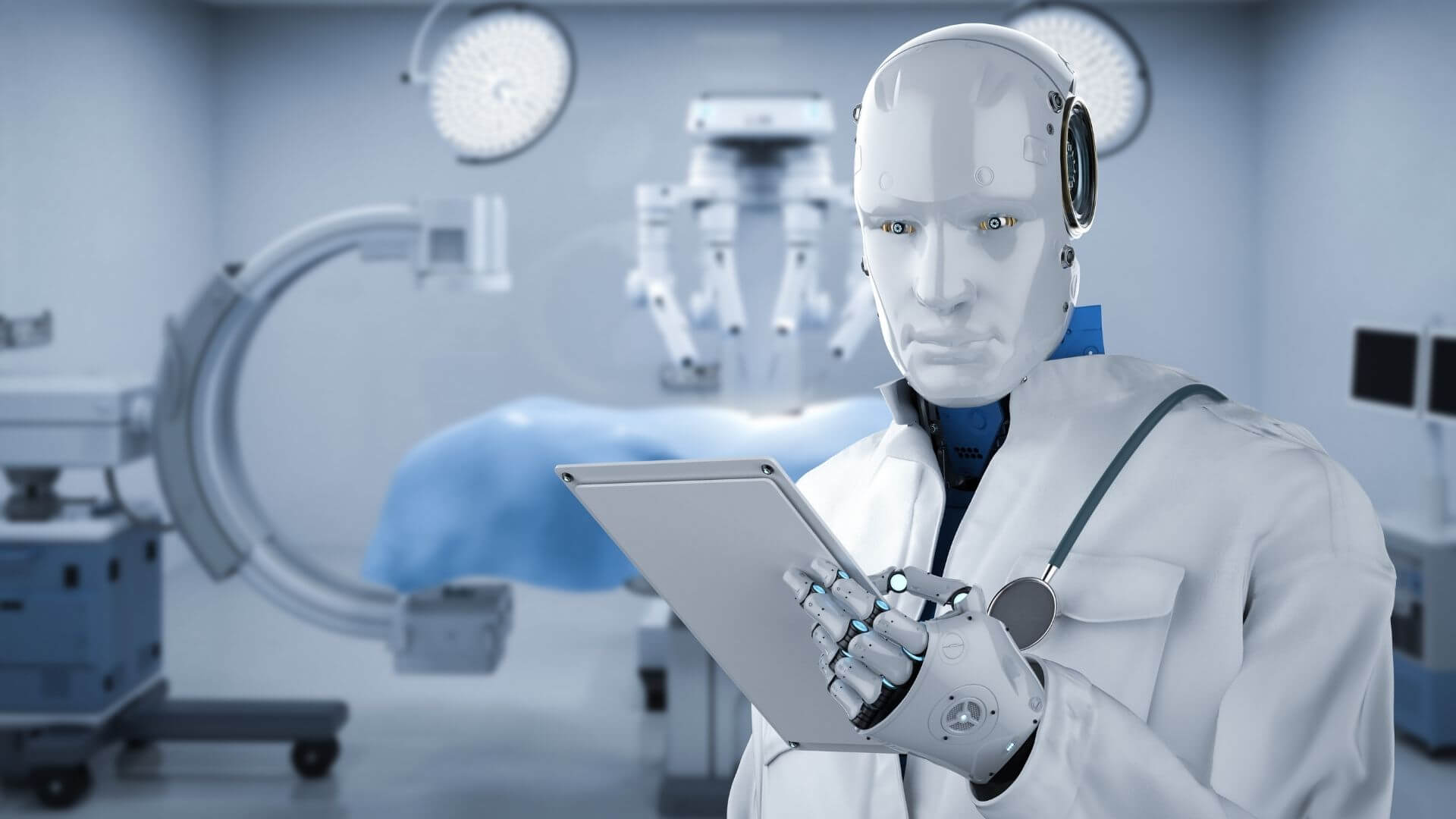
Denn eine korrekte Diagnose hängt immer vom Erfahrungsschatz des Therapeuten ab. Und ein erfahrener Therapeut hat tatsächlich bessere Erfolge als Anfänger.
Es gibt bereits Apps, um Diagnostik zu betreiben. Ein wichtiger Aspekt, den viele in ihrer Begeisterung für diese neue Technologie jedoch nicht berücksichtigen, ist, dass die Genauigkeit der Diagnose von dem Weltbild abhängt, mit dem das Programm gefüttert wurde.
Denn die App kann nur auf der Grundlage eines programmierten Datensatzes Diagnosen durchführen. Das bedeutet, dass die App bzw. die Diagnose eines KI-Programms nur so gut oder so schlecht ist, wie die ursprüngliche Programmierung und die Daten, mit denen das Programm gefüttert wurde.
Ein KI-Programm, das auf einem falschen Weltbild über den menschlichen Körper basiert, produziert folgerichtig lauter Fehldiagnosen.
Dr. Welch und Dr. Blech untersuchten mit Daten von großangelegten Screening-Versuchen, mit welchem Ausmaß Fehldiagnosen vertreten sind. Sie fanden heraus, dass etwa 25% der aller durch Mammographie gefundenen Brustkrebs und ca. 60% aller Prostatafälle durch Antigentest entdeckt wurden, Überdiagnosen sein könnten.
Eine Überdiagnose ist keine Fehldiagnose, sondern eine tatsächlich vorhandene “Krankheit”, die aber während des gesamten Lebens des Patienten niemals schlimme Symptome verursachen würden.
Die moderne Medizin arbeitet nicht immer wissenschaftlich
Ein einfaches Beispiel ist, wenn jemand eine als gut- oder bösartig bewertete Diagnose bekommt. Sie hat nichts mit objektiver Sachlichkeit zu tun, sondern spiegelt die religiösen bzw. kirchlichen Hintergründen der Medizin wider.
Wenn man also anfängt, Dinge als gut oder bösartig zu beurteilen, verlässt man die Ebene der Naturwissenschaft und befindet sich im Bereich der Religion und des Glaubens. Und das ist leider heute immer noch der Fall.
Und das ist der Grund, warum ich sage, dass Diagnosen gefährlich sind. Denn Fehldiagnosen und die damit verbundenen Prognosen wirken wie selbsterfüllende Prophezeiungen. Das ist der sogenannte Nocebo-Effekt – also das Gegenteil des allseits bekannten Placebo-Effekts. Allein die Vorstellung von einer Krankheit kann diese verursachen oder verstärken.
Wenn Menschen heute eine Verdachtsdiagnose hören, haben sie sofort ein ungutes Gefühl und gehen ins Internet, um sich zu informieren. Sie schauen bei Wikipedia oder auf anderen Portalen nach und finden dort sogleich die Prognose mit ihrer Überlebenswahrscheinlichkeit.
Es kann sogar passieren, dass eine Blutprobe im Labor vertauscht wird und es deshalb zu einer Fehldiagnose kommt. Der betroffene Mensch denkt dann unter Umständen, er muss in den nächsten Monaten sterben, obwohl das gar stimmt.
Tod verkünden heißt Tod geben.
Christoph Wilhelm Hufeland (1762 - 1836), deutscher Mediziner, königlicher Leibarzt von Preußen
Zusammenfassung
Diagnosen sind sinnvoll, um therapeutisch zu arbeiten. Sie werden jedoch zu einer Gefahr, wenn sie zu Diagnoseschocks führen oder Menschen aufgrund von Fehldiagnosen falsch behandelt werden.
Es ist daher entscheidend, wie eine Diagnose kommuniziert wird. Ärzte und Therapeuten sollten immer den Nocebo-Effekt (umgekehrter Placebo-Effekt) berücksichtigen.
Und Betroffene sollten die Meinungen von verschiedenen Therapeuten und Spezialisten einholen. Es können unterschiedliche Diagnosen von unterschiedlichen Spezialisten desselben Fachgebiets gestellt werden. Der eine sagt womöglich, es ist gefährlich, und der andere sagt, es sei völlig harmlos.
Für den Therapeuten mag der Unterschied von einer Fehldiagnose und einer korrekten Diagnose wenig Konsequenzen haben. Aber für den betroffenen Menschen kann es unter Umständen über Leben oder Tod entscheiden, wenn er daran glaubt. Und deshalb können Diagnosen so gefährlich sein.
Ich wünsche Dir alles Gute und vor allem bleib gesund.

